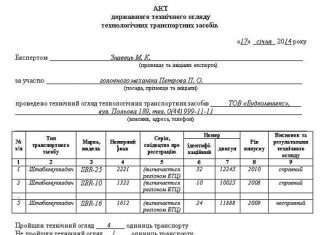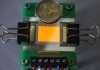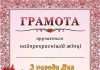Jüngste Ausgrabungen auf einem mittelalterlichen christlichen Friedhof in Aarhus, Dänemark, haben eine bemerkenswerte Entdeckung erbracht: 77 Skelette, die etwa 900 Jahre alt sind. Diese Bestattungen, die vor Bauarbeiten in der Nähe der St.-Olaf-Kirche ausgegraben wurden, bieten einen einzigartigen Einblick in das Leben, die Krankheiten und den Glauben einiger der ersten christlichen Einwohner der Stadt und beleuchten eine kritische Phase des kulturellen Wandels in Dänemark.
Ein Ort von historischer Bedeutung
Die Ausgrabungen konzentrierten sich auf einen Teil des Friedhofs rund um Sankt Olufs Kirke (St. Olafs Kirche), einen Ort, der als eine der ältesten christlichen Stätten in Aarhus gilt. Die Kirche selbst wurde im 12. Jahrhundert erbaut und nach Olav Haraldsson benannt, einem norwegischen König aus dem 11. Jahrhundert, der vom Heidentum zum Christentum konvertierte und schließlich ein Heiliger wurde. Die Entdeckung ist besonders bedeutsam, weil sie das Wachstum des Christentums in Dänemark nach dem Niedergang des nordischen Heidentums und dem Ende der Wikingerzeit im Jahr 1066 dokumentiert. Forscher gehen davon aus, dass weit mehr Skelette unter nahegelegenen modernen Straßen und Gebäuden liegen könnten, was den Umfang dieser historischen Momentaufnahme erheblich erweitert.
Kulturelle Veränderungen: Das Christentum schlägt Wurzeln
Historisch gesehen befanden sich nordische heidnische Friedhöfe typischerweise weit entfernt von Siedlungen. Die frühen Christen suchten jedoch nach Begräbnisplätzen auf etwas, das sie als „heiligen Boden“ betrachteten, beispielsweise in einer Kirche, was die wachsende Bedeutung religiöser Institutionen widerspiegelte. Dieser Wunsch nach Nähe ist am St.-Olaf-Gelände deutlich zu erkennen, wo sich die Bestattungen in der Nähe des Herzens von Aarhus befinden.
Unterschiedliche Bestattungspraktiken offenbaren Überzeugungen
Die neu entdeckten Bestattungen weisen typische Merkmale frühchristlicher Praktiken auf und bestätigen die christliche Identität des Ortes weiter. Die Skelette wurden mit dem Kopf nach Westen und den Füßen nach Osten ausgerichtet – eine übliche Anordnung bei frühchristlichen Bestattungen. Es wurde angenommen, dass diese Ausrichtung dafür sorgte, dass der Verstorbene Zeuge des Zweiten Kommens Jesu Christi werden konnte, das im Osten, in Richtung Jerusalem und der aufgehenden Sonne, stattfinden sollte.
Eine Mischung aus alten und neuen Überzeugungen
Während die Bestattungen eindeutig auf den christlichen Glauben hinweisen, vermuten Forscher, dass viele Dänen zu dieser Zeit neben ihren christlichen Praktiken wahrscheinlich auch einige nordische heidnische Glaubensvorstellungen beibehielten. Wie der Archäologe Mads Ravn erklärte, waren diese frühen Konvertiten möglicherweise „ein bisschen opportunistisch“ und bezogen manchmal nordische Traditionen als Schutz ein. Während in anderen nordischen christlichen Bestattungen Amulette in Form von Thors Hammer, einem Schutzsymbol des nordischen Gottes Thor, gefunden wurden, fehlten sie an der St. Olaf-Grabstätte.
Königliche Bekehrung und bleibende Traditionen
Die Ausgrabungen bieten Kontext für eine umfassendere historische Erzählung. Der dänische König Harald Bluetooth aus der Wikingerzeit, der etwa von 958 bis 986 n. Chr. regierte, behauptete bekanntlich, er habe die Dänen zum Christentum konvertiert, eine Aussage, die um 965 n. Chr. auf den Jelling-Steinen festgehalten wurde. Allerdings beschäftigte sogar Harald selbst eine völva, eine Art nordischer Schamane, was auf eine Zeit religiöser Unbeständigkeit und den anhaltenden Einfluss älterer Glaubensvorstellungen hinweist. Wie Ravn anmerkt, setzten diese frühen Anhänger des Christentums „auf beide“ Glaubenssysteme.
Die Entdeckung dieser 900 Jahre alten Gräber bietet eine seltene Gelegenheit, einen entscheidenden Moment in der dänischen Geschichte zu verstehen, der durch den Übergang vom nordischen Heidentum zum Christentum gekennzeichnet ist. Die ausgegrabenen Skelette und die damit verbundenen Bestattungspraktiken bieten unschätzbare Einblicke in das Leben, die Gesundheit und die sich entwickelnde religiöse Landschaft der frühen Aarhuser und zeigen eine Zeit, in der neuer Glaube mit dauerhaften Traditionen verknüpft war.